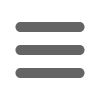Corona und Impfpflicht: Was können ArbeitgeberInnen von ihren Beschäftigten verlangen?
Die möglich gewordene Impfung gegen das Corona-Virus gilt als der einzig zielführende Weg, um die aktuelle Krise nachhaltig zu überwinden. Deshalb überrascht es nicht, dass die öffentliche Diskussion hierüber einen breiten Raum einnimmt. Dabei geht es zum einen zwangsläufig um die Frage der Priorisierung impfwilliger Personen, weil der zur Verfügung stehende Impfstoff jedenfalls bis in das 2. Quartal 2021 relativ begrenzt sein wird. Zum anderen gibt es etwa Überlegungen, den bereits geimpften Personen zukünftig einen anderen Status als den übrigen zuzubilligen, was zum Beispiel für den Luftverkehr oder die Gastronomie Bedeutung haben kann. Teilweise wird sogar schon der Ruf nach einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Corona-Virus laut, die es immerhin schon in anderem Zusammenhang gibt.
Auch und gerade für ArbeitgeberInnen handelt es sich bei der Impfung gegen das Corona-Virus um ein zentrales Thema, um eine möglichst ungestörte Wertschöpfung in den Betrieben sicherzustellen. Damit korrespondiert grundsätzlich das arbeitgeberseitige Interesse, eine Impfpflicht gegenüber den Beschäftigten rechtlich und faktisch durchsetzen zu können. Die mögliche Beeinträchtigung betriebsorganisatorischer Abläufe resultiert natürlich in erster Linie aus der Arbeitsunfähigkeit von ArbeitnehmerInnen, die selbst an Covid 19 erkranken. Zudem wäre hiermit realistischerweise eine Quarantänepflicht für deren kollegiales Umfeld verbunden. Auch ist es denkbar, dass zumindest von Teilen der Belegschaft eine Impfung aller Beschäftigten in der Hoffnung gefordert wird, dass eine solche Maßnahme die Infektionsgefahr mindert und damit die eigene Gesundheit über die etwaig persönliche Impfung hinaus zusätzlich schützen kann.
Wie sieht es jedoch in dem Zusammenhang mit dem Schutz der ArbeitgeberInnen selbst aus, um eine Impfung gegen das Corona-Virus auf möglichst breiter Basis zu realisieren? Verfügen sie dafür allein über die Kraft ihrer Argumente oder gibt es auch rechtliche Handlungsoptionen?
Gesetzliche Regelung
Eine gesetzliche Impfpflicht im Hinblick auf das Corona-Virus existiert jedenfalls derzeit bekanntlich nicht. Damit fehlt es insoweit auch an einer Legitimation für ArbeitgeberInnen, die Impfung von ihren Beschäftigten zu fordern, sobald ihnen überhaupt ein Impfangebot gemacht werden kann. Allerdings ist die rechtspolitische Diskussion über eine Impfpflicht in dem Sinne nicht unrealistisch, als dass eine solche gesetzliche Anordnung je nach Ausgestaltung rechtlich zulässig erscheint.
Dies erschließt sich aus der Bewertung des Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention, worauf das Infektionsschutzgesetz (IfSG) in § 20 Abs. 8 u. 9 zwischenzeitlich regelt, dass der Zutritt zu gewissen Einrichtungen wie auch die Aufnahme einer Tätigkeit in solchen Einrichtungen nur bei einem entsprechenden Impfnachweis zulässig ist. Die Regelung lag bereits dem Bundesverfassungsgericht zur Bewertung vor, das entsprechende Eilanträge hiergegen zurückgewiesen hat (Beschl. v. 11.05.2020, Az. 1 BvR 469/20 und 1 BvR 470/20). Zu einer vergleichbaren Wertung kam schon das Bundesverwaltungsgericht vor Jahrzehnten, das nämlich die Rechtmäßigkeit einer Impfpflicht gegen Pocken im Jahr 1959 bejahte (Urt. v. 14.07.1959, Az.: I C 170/56).
Arbeitsvertragliche Regelung
Wenn es schon keine gesetzliche Regelung zugunsten einer Impfpflicht gegen das Corona-Virus gibt und eine solche nach den politischen Bekundungen wohl auch nicht zu erwarten ist, stellt sich die Frage, ob ArbeitgeberInnen dasselbe Ergebnis durch eine entsprechende Bestimmung in ihren Arbeitsverträgen realisieren können.
Soweit es in diesem Zusammenhang um die Bestandsbelegschaft geht, scheiterte ein solches Vorhaben jedoch bereits aus faktischen Gründen. Zwar wäre es abstrakt betrachtet möglich, einen Konsens hierüber zu erzielen. Dies fände aber denknotwendig allein mit denjenigen Beschäftigten statt, die ohnehin schon impfwillig sind und damit auch nicht erst durch eine vertragliche Regelung hierzu angehalten werden müssten. Die andere Gruppe, die zu einer Impfung nicht bereit wäre, lehnte konsequenterweise eine vertragliche Verpflichtung zur Impfung ab. Ein entsprechender Konsens wäre jedoch methodisch betrachtet die Mindestvoraussetzung, um hierüber eine Rechtspflicht zu begründen, die den ArbeitgeberInnen erst bei Verstößen hiergegen weitere rechtliche Handlungsoptionen ermöglichte.
Selbst wenn es zum Teil gelänge, eine vertragliche Regelung zugunsten der Impfpflicht zu vereinbaren, bliebe die Frage der Zulässigkeit einer solchen Regelung. Dies könnte zum einen Bedeutung gewinnen, wenn ArbeitnehmerInnen, die zunächst einer Impfpflicht im Arbeitsvertrag zugestimmt haben, später von ihrer ursprünglichen Impfbereitschaft – aus welchen Gründen auch immer – wieder abrücken. Die Frage ist insbesondere aber im Zusammenhang mit Neueinstellungen bedeutsam. Ggf. könnten ArbeitgeberInnen nämlich erreichen, dass zumindest für die zukünftigen Beschäftigten eine Impfpflicht von vornherein in deren Arbeitsverträgen vereinbart wird. Erfahrungsgemäß ist die Wahrscheinlichkeit bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses in tatsächlicher Hinsicht größer, bestimmte Erwartungen auf Arbeitgeberseite umzusetzen, als dies in laufenden Arbeitsverhältnissen durch die dann notwendige konsensuale Änderung der schon bestehenden Arbeitsverträge möglich ist.
In beiden Fällen, also sowohl im laufenden als auch im neu zu begründenden Arbeitsverhältnis, gilt es zu beachten, dass es sich bei ArbeitnehmerInnen um sog. Verbraucher im Sinne des Gesetzes handelt. Infolge der Verwendung vertraglicher Regelungen durch ArbeitgeberInnen ist gem. § 310 Abs. 3 Nr. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) eine Kontrolle nach dem Maßstab der gesetzlichen Beschränkungen im Hinblick auf Allgemeine Geschäftsbedingungen erforderlich. Danach liegt eine unangemessene Benachteiligung gem. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB u.a. dann vor, sofern die vertragliche Bestimmung von wesentlichen Grundgedanken gesetzlicher Regelungen abweicht. Genau davon wird vorliegend auszugehen sein, weil eine im Arbeitsvertrag geregelte Impfpflicht in geschützte Grundrechtspositionen von impfunwilligen Arbeitnehmern eingreift. Denn hierdurch wären zumindest die allgemeine Handlungsfreiheit und körperliche Unversehrtheit betroffen, was im Streitfall voraussichtlich dazu führte, dass ein Arbeitsgericht die Begründung einer Rechtspflicht zur Impfung im Arbeitsvertrag als unwirksam qualifizierte.
Weisungsbefugnis von ArbeitgeberInnen
Die vertragliche Ausgestaltung eines jeden Arbeitsverhältnisses hat aus einer Vielzahl von Gründen stets inhaltliche Grenzen. Vor dem Hintergrund ist die Weisungsbefugnis von ArbeitgeberInnen zu sehen, die § 106 der Gewerbeordnung (GewO) regelt. Danach können ArbeitgeberInnen den Inhalt, den Ort und die Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind.
Letzteres ist in der gegebenen Situation nicht der Fall. Es fehlt nämlich an Regelungen jedweder Art, die eine Impfpflicht gegen das Corona-Virus begründen, wobei selbst eine entsprechende vertragliche Regelung aus den gezeigten Gründen rechtlich keinen Bestand hätte und deshalb im Ergebnis ebenfalls nicht existent wäre.
Gleichwohl kann die arbeitgeberseitige Weisungsbefugnis einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit von ArbeitnehmerInnen, die mit jeder Impfung verbunden wäre, für sich nicht rechtfertigen. Denn hierbei handelt es sich nicht um ein dienstliches, sondern um ein außerdienstliches Verhalten von Beschäftigten. Folglich können ArbeitgeberInnen auch nicht eine Impfung mit Aussicht auf rechtlichen Erfolg verlangen, solange es keine gesetzliche Impfpflicht gibt.
Hausrecht als Methode der Wahl
Unabhängig von dem Bestehen einer Impfpflicht haben ArbeitgeberInnen das Hausrecht über ihre Betriebe. Dies ermöglicht es grundsätzlich, im Einzelfall darüber zu entscheiden, wem der Zutritt gewährt wird und wem nicht. Damit könnte das Hausrecht prinzipiell als Instrument genutzt werden, um nur noch solchen Beschäftigten den Zugang zum Betrieb zu gestatten, die ihrerseits zuvor einen Impfnachweis erbringen.
In diesem Zusammenhang ergäben sich aber bereits datenschutzrechtliche Probleme, weil die von ArbeitgeberInnen geforderte Auskunft zum Impfstatus ihrer MitarbeiterInnen als schützenswerte Gesundheitsdaten im Sinne von Art. 9 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu bewerten sind. Außerdem handelte es sich dabei nicht um ein Arbeitsverhalten, sondern um ein Ordnungsverhalten der Beschäftigten, was den Gesundheitsschutz anbetrifft. Deshalb wären selbst bei einer datenschutzrechtlichen Zulässigkeit solcher Maßnahmen wohl auch die Anwendungsfälle im Sinne von § 87 Abs. 1 Nrn. 1 und 7 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) mit der Folge gegeben, dass der Betriebsrat zwingend beteiligt werden müsste.
Die wesentliche Problematik dürfte für ArbeitgeberInnen aber in dem gesetzlichen Maßregelungsverbot gem. § 612 a BGB bestehen, wonach eine Benachteiligung von Beschäftigten untersagt ist, wenn sie zulässigerweise ihre Rechte ausüben. In Ermangelung einer gesetzlichen Impfpflicht ist genau hiervon auszugehen, sofern sie die Auskunft über eine etwaig erfolgte Impfung verweigern. Selbst wahrheitswidrige Angaben müssten rechtlich ohne Konsequenz bleiben, weil auch in anderem Zusammenhang gegenüber ArbeitgeberInnen auf nicht zulässige Fragen sanktionslos gelogen werden darf.
Ein arbeitgeberseitiges Zutrittsverbot wegen des fehlenden Nachweises über eine durchgeführte Impfung wäre von Rechts wegen zwar dennoch zu beachten, hieran knüpfte sich dann aber insbesondere der sog. Annahmeverzug als rechtliche Konsequenz. Damit bliebe also der Vergütungsanspruch der Beschäftigten erhalten, die ihre Arbeitsleistung allein deshalb nicht erbringen können, weil deren ArbeitgeberInnen den Zutritt zum Betrieb wegen eines fehlenden Impfnachweises untersagen.
Zudem gilt es zu beachten, dass ArbeitnehmerInnen auch grundsätzlich einen Anspruch auf faktische Beschäftigung haben, der somit unabhängig davon besteht, ob ArbeitgeberInnen ihrer Vergütungspflicht im Stadium des Annahmeverzuges tatsächlich nachkommen. Dieser Anspruch könnte natürlich ebenso wie der Anspruch auf Vergütung bei einer etwaig ausgesetzten Gehaltszahlung mit gerichtlicher Hilfe durchgesetzt werden.
Kündigung als Alternative
Wenn es schon aus den gezeigten Gründen nicht möglich ist, eine Impfung der Beschäftigten rechtlich und tatsächlich zu realisieren, stellt sich die Frage, ob sich ArbeitgeberInnen zumindest im Wege einer Kündigung von den ArbeitnehmerInnen trennen können, die für sich eine Impfung ablehnen. Erste Fälle dieser Art gibt es immerhin schon, die deshalb voraussichtlich in Kürze die Arbeitsgerichtsbarkeit durch entsprechende Kündigungsschutzklagen beschäftigen werden.
Wie steht es jedoch um die Erfolgsaussicht solcher Klagen? Hierzu ist Folgendes festzustellen:
Die rechtliche Abwesenheit einer Impfpflicht hat zunächst einmal zur Folge, dass die Ablehnung einer Impfung kein Pflichtverstoß sein kann. Damit entfällt von vornherein die Möglichkeit, eine solche Haltung als begründeten Anlass für eine verhaltensbedingte Kündigung zu nehmen. Aus demselben Grund wäre schon eine Abmahnung insoweit nicht statthaft, weil dies ebenfalls einen Verstoß gegen bestehende Pflichten zur Voraussetzung hätte, die im Zusammenhang mit einer Impfung gerade nicht bestehen.
Allerdings werden die ArbeitgeberInnen in den jetzt zu erwartenden Klagen versuchen, die jeweils streitgegenständliche Kündigung mit personenbedingten Gründen zu rechtfertigen. Auf einen Pflichtverstoß kommt es hierbei nämlich nicht an. Rechtlich bedeutsam können vielmehr auch solche Umstände sein, die ohne irgendein Verschulden auf ein in der Sphäre der gekündigten Person liegenden „Störquelle“ beruhen. In der Praxis werden solche Kündigungen ganz überwiegend durch krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit veranlasst.
Eine ähnliche rechtserhebliche Betroffenheit von ArbeitgeberInnen könnte aber vielleicht auch in besonderen Fallkonstellationen bei einer abgelehnten Impfung gesehen werden. Dabei ist insbesondere an exponierte Arbeitsplätze wie etwa in Pflegeheimen zu denken. Zudem erscheint es vorstellbar, dass dort nicht allein die ArbeitgeberInnen eine durchgängige Impfung wünschen, sondern dies auch die Gruppe der impfwilligen Beschäftigten verlangt und gleichzeitig die ArbeitgeberInnen durch ihre Ankündigung unter Druck setzt, dass sie, die Beschäftigten, andernfalls ihre Arbeitsverhältnisse durch eine Eigenkündigung beenden werden. Denn auch eine Impfung bietet keinen absoluten Schutz davor, selbst noch an Covid 19 zu erkranken.
Die Rechtmäßigkeit jeder Kündigung wird jedoch u.a. an ihrer Verhältnismäßigkeit gemessen. Deshalb sind ArbeitgeberInnen verpflichtet, alle zumutbaren und geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, die im Rahmen der betrieblichen Interessen eine Kündigung vermeiden helfen (Bundesarbeitsgericht Urt. v. 12.07.2007 – 2 AZR 716/06). Schon bisher kamen gerade in Pflegeheimen systemisch Schnelltests zur Anwendung, um infizierte Personen mit einem zumindest hohen Maß an Wahrscheinlichkeit zu erkennen und ggf. vom Dienst zu suspendieren. Diese Möglichkeit besteht natürlich auch weiterhin und ist schon für sich ein bedeutsames Faktum, das gegen die Verhältnismäßigkeit einer personenbedingten Kündigung sprechen könnte. Im Übrigen bliebe stets zu prüfen, ob und mit welcher Wirkung die Gefährdung anderer nicht auch durch eine geänderte Arbeitsorganisation zumutbar gemindert werden kann.
Die soziale Rechtfertigung einer personenbedingten Kündigung gegenüber nicht zur Impfung bereiten Personen wird aber jedenfalls daran scheitern, dass aktuell keine gesicherte Erkenntnis darüber besteht, ob und inwieweit eine Impfung die Infektionsgefahr zulasten anderer überhaupt ausschließt. Nach zutreffender Ansicht fehlt es damit schon an der von der höchstrichterlichen Rechtsprechung vorausgesetzten nachweislichen Geeignetheit der entsprechenden Maßnahme. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass die in dem Zusammenhang erhobenen Kündigungsschutzklagen jedenfalls bis auf Weiteres eine erhebliche Aussicht auf Erfolg haben werden.
Maßnahmen zum Arbeitsschutz
Mit Rücksicht darauf, dass eine Impfpflicht aus den gezeigten Gründen letztlich nicht durchsetzbar sein wird, bleiben natürlich tatsächliche Anstrengungen möglich, um die Gefahr einer Infektion von Beschäftigten zumindest zu reduzieren. Ein solches Vorgehen erscheint nicht nur in vielerlei Hinsicht zweckmäßig, sondern ist auch von Rechts wegen geboten.
Gem. § 3 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (ArbSchG) sind ArbeitgeberInnen nämlich verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Auch § 618 BGB legt ArbeitgeberInnen verschiedene Schutzpflichten auf, um einer Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Beschäftigten im Rahmen des Möglichen entgegenzuwirken.
Mit Bezug auf die aktuelle Pandemie hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 16.04.2020 den sog. SARS-CorV-2-Arbeitsschutzstandard vorgegeben. Dort findet sich ein Maßnahmenkatalog zur Risikominderung, der mit fachkundiger Unterstützung erstellt wurde; eine unmittelbare normative Verpflichtung ist hiermit jedoch nicht verbunden, weil es sich letztlich nur um ministerielle Empfehlungen und damit um solche der Exekutive handelt. Allerdings erscheint es nicht unrealistisch, dass dieser Maßstab in Streitfällen von der Arbeitsgerichtsbarkeit auch zur Konkretisierung der abstrakt beschriebenen Handlungspflichten für ArbeitgeberInnen in dem oben zitierten ArbSchG sowie im BGB herangezogen werden.
Fazit
Im Ergebnis bleibt damit festzuhalten, dass die eingangs aufgeworfene Frage wie folgt zu beantworten ist:
ArbeitgeberInnen haben im Wesentlichen nur die Kraft ihrer Argumente, um etwa mit Hilfe von BetriebsärztInnen oder in sonstiger Weise die Beschäftigten von der Zweckmäßigkeit einer Impfung gegen das Corona-Virus zu überzeugen. Mehr sollte und darf es auch nicht sein, um nicht selbst rechtswidrig zu handeln und damit verschiedene unerwünschte Rechtsfolgen auszulösen. In dem Zusammenhang geht es nicht allein um arbeitsrechtliche Konsequenzen, sondern ggf. auch um strafrechtliche, weil je nach Vorgehensweise der Vorwurf einer Nötigung erhoben werden könnte.
Die Erkenntnis entbindet ArbeitgeberInnen jedoch nicht davon, geeignete Maßnahmen zum Schutze ihrer Beschäftigten zu treffen, um auch ohne eine obligatorische Verimpfung der Belegschaft den Risiken des Corona-Virus zu begegnen. Art und Umfang solcher Maßnahmen sind zwangsläufig einzelfallbezogen. Stets handelt es sich insoweit aber um die Beachtung gesetzlicher Schutzpflichten, deren Missachtung erhebliche wirtschaftliche Folgen haben kann.
Ansprechpartner

Dr. Uwe Julius Faustmann
Arbeits- und Dienstvertragsrecht, Insolvenzen und Sanierungen, Wirtschaft und Finanzen
0201 1095 708 | faustmann@raehp.de